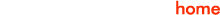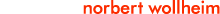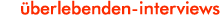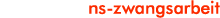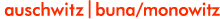1. Prozess gegen Bernhard Rakers
Mit Vorlage der Schwurgerichtsanklage vom 21. Juli 1952 beantragte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht (LG) Osnabrück die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Bernhard Rakers. Grundlage der Anklageschrift waren die Vernehmungsniederschriften von 31 Zeugen, die im Rahmen des Vorverfahrens vernommen worden waren. Mit Beschluss vom 20. August 1952 eröffnete das LG Osnabrück das Hauptverfahren. Am 11. Dezember 1952 begann sodann die Hauptverhandlung, die insgesamt 17 Verhandlungstage dauerte. Im Rahmen der Beweisaufnahme wurden 49 Zeugen eidlich vernommen und 23 Protokolle von Zeugenvernehmungen (darunter Wollheims drei Vernehmungen von 1950/1951)[1] sowie zahlreiche Urkunden verlesen.
Rakers wurde der schweren Körperverletzung mit bleibenden Gesundheitsschäden der Verletzten bzw. mit Todesfolge sowie des Mordes angeklagt. Neben der eigenmächtigen und willkürlichen Tötung von Häftlingen in den KZs Esterwegen und Sachsenhausen sowie auf dem Werksgelände der I.G., im KZ Buna/Monowitz und während des Bahntransports im Januar 1945 wurde Rakers insbesondere der Beteiligung an Selektionen in Buna/Monowitz beschuldigt. Gemeinschaftlich mit dem Schutzhaftlagerführer von Buna/Monowitz, SS-Obersturmführer Vinzenz Schöttl (1905–1946), sowie mit SS-Ärzten hatte Rakers nach Zeugenbekundungen bei Block- und Lagerselektionen sowie beim Aus- und Einmarsch der Häftlingskommandos geschwächte und entkräftete Häftlinge als „arbeitsunfähig“ ausgewählt. Die Selektierten wurden „listenmäßig“ verzeichnet („SB-Transportlisten“) und „karteimäßig“ mit der Bezeichnung „SB“ („Sonderbehandlung“), d.h. Tötung in den Gaskammern von Birkenau, erfasst.
Weder in den im Rahmen des Vorverfahrens gefertigten Vernehmungsprotokollen noch in der Anklageschrift finden sich Hinweise auf die Teilnahme von Vertretern der I.G. Farbenindustrie AG an Selektionen.[2] Von dem Chemieunternehmen, vom Nürnberger Prozess gegen I.G. Farben (1947/48) und der vom amerikanischen Militärgericht festgestellten „direkten strafrechtlichen Verantwortlichkeit“[3] der I.G. Farben-Angestellten Walther Dürrfeld, Heinrich Bütefisch und Otto Ambros, ist in der Schwurgerichtsanklage an keiner Stelle die Rede. Die in Nürnberg zu acht bzw. zu sechs Jahren Haft verurteilten I.G.-Mitarbeiter waren zur Zeit des Rakers-Prozesses bereits begnadigt und auf freiem Fuß.
Den Exzesstäter Rakers verurteilte das Osnabrücker Schwurgericht am 10. Februar 1953 wegen schwerer Körperverletzung im Amt, versuchten sowie vollendeten Mords und wegen Beihilfe zum Mord in fünf Fällen zu lebenslangem Zuchthaus und zu einer Gesamtstrafe von 15 Jahren.[4] Die bürgerlichen Ehrenrechte erkannte ihm das Gericht auf Lebenszeit ab. Das Urteil wurde im November 1953 rechtskräftig. Rakers Mitwirkung an Selektionen qualifizierte das erkennende Gericht nicht als Mittäterschaft zum Mord sondern als Mordbeihilfe. Aufklären konnten die Richter nicht, ob neben dem Schutzhaftlagerführer Schöttl und den beteiligten SS-Lagerärzten und SS-Sanitätsdienstgraden auch Rakers Entscheidungen über Leben und Tod der Häftlinge getroffen hatte.
(WR)