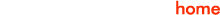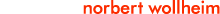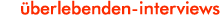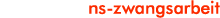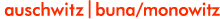David Salz
00:00:00 Kindheit im NS
00:09:32 Deportation/Selektion
00:12:45 Alltag & Überleben im KZ Buna/Monowitz
00:27:34 Todesmärsche
00:31:26 KZ Mittelbau-Dora
00:34:49 Befreiung
00:38:50 Nachkriegszeit
00:43:00 Auschwitz-Prozess/Entschädigung
David Salz wurde 1929 in Berlin als jüngerer von zwei Söhnen geboren. Seinem älteren Bruder Zeli wie auch seinen Großeltern und seiner Tante gelang es, nach Palästina zu emigrieren. Doch seine Mutter, Dora Salz, wollte nicht ohne den Vater, Josef Salz, aufbrechen und wartete auf seine Entlassung: Er war bereits 1936 von der Gestapo verhaftet worden und wurde Weihnachten 1939 in der Haft erschossen.
David lebte allein mit seiner Mutter in Berlin. Er besuchte die jüdische Volksschule, seine Mutter arbeitete bei Siemens. Anfang März 1943 kehrt sie eines Tages nicht von der Arbeit zurück. Auf der Suche nach ihr wurde David Salz von der Gestapo verhaftet und kurz darauf nach Auschwitz deportiert. Erst später erfuhr er, dass seine Mutter nur wenige Tage zuvor ebenfalls nach Auschwitz deportiert und gleich vergast worden war.
David Salz, gerade erst 13, gab sich als 16jähriger Elektriker aus und kam ins KZ Buna/Monowitz. „Ich habe mir geschworen: wenn ich das hier wegen des Wortes ‚Elektriker‘ überlebe, dann will ich nachher Elektriker werden.“ [1] Durch die Unterstützung älterer Inhaftierter, besonders durch Erich Markowitsch und den Schneider Kowalski, die ihm zusätzliches Essen organisierten und ihn vor den brutalsten Kapos in Schutz nahmen, gelang es David Salz, zu überleben.
Der Todesmarsch, auf den die SS die Häftlinge des KZ Buna/Monowitz am 18. Januar 1945 trieb, brachte David Salz gemeinsam mit 10.000 weiteren Häftlingen über Gleiwitz ins KZ Mittelbau-Dora. Aus einem Nebenlager von Mittelbau-Dora gelang ihm während der Bombardierung die Flucht. Er musste erneut vor der antisemitischen Zivilbevölkerung fliehen und sich einige Tage im Wald verstecken, bis er eines Morgens völlig entkräftet auf amerikanische Soldaten traf. Er kam in ein Militärhospital, das später von der russischen Armee übernommen wurde. Nach der Genesung kehrte er nach Berlin zurück.
David Salz konnte es nicht ertragen, wie die ehemaligen Nazi-Funktionäre nach und nach in ihre alten Posten zurückkehrten, und beschloss, Deutschland zu verlassen. Seine Freunde Herman Shine und Max Drimmer versuchten, ihn zur Emigration in die USA zu überreden, aber David Salz emigrierte 1946 ins Mandatsgebiet Palästina. Seine Tante konnte ihn nicht unterstützen, so ging er zunächst in einen Kibbuz, verließ diesen aber bald wieder, da ihn der Geruch des Kuhdungs an die Lagerzeit erinnert. Mit viel Engagement gelang es ihm, eine Lehrstelle als Elektriker zu bekommen. Bis zu seiner Pensionierung 43 Jahre später arbeitete er bei den israelischen Elektrizitätswerken. Er heiratete Chaya Salz, das Paar bekam zwei Söhne, Yossi und Doron.
Nach dem Eichmann-Prozess im Jahr 1961 begann David Salz, von seinen Erlebnissen in Auschwitz zu sprechen. 1964 war er im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess als Zeuge geladen; dies belastete ihn so sehr, dass er noch vor Ende des Prozesses wieder abreiste.
Heute lebt David Salz als Witwer in Givatayim, Israel. Derzeit kämpft er darum, die deutsche Staatsangehörigkeit wieder zu bekommen, um seinen Kindern das Leben im Ausland zu erleichtern. Das Bundesverwaltungsamt lehnte seinen Antrag ab, da es nicht als erwiesen ansah, dass David Salz nach 1945 die deutsche Staatsbürgerschaft besessen habe.
Anhand von Video-Interviews und Gesprächen mit David Salz schrieb die Dramatikerin Katharina Schlender das Theaterstück Der Elektriker (UA Hans-Otto-Theater Potsdam 2006, R: Uwe Eric Laufenberg) über seine Zeit im KZ Buna/Monowitz.
(SD)