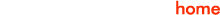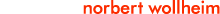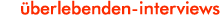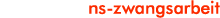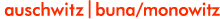Deportationen nach Auschwitz-Birkenau

© National Archives, Washington, DC

© National Archives, Washington, DC

© Matthias Naumann
Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau war das Ziel von Deportationszügen mit Juden aus ganz Europa. Das von Adolf Eichmann (1906–1962) geleitete Referat IV B 4 („Judenreferat“) des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) in Berlin organisierte die „Sonderzüge“ genannten Transporte der Deutschen Reichsbahn.
In den Monaten März bis Juni 1942 kamen in Auschwitz Transporte an, die noch keiner Selektion unterworfen wurden. Die aus der Slowakei deportierten Jüdinnen brachte die SS in das „Frauenkonzentrationslager“ in Auschwitz I. Der erste, Ende März 1942 aus Paris eingetroffene Transport kam gleichfalls geschlossen ins Lager. Anfang Juli 1942 begann die Lagerführung, die angekommenen Juden zu selektieren. Wer als „arbeitsfähig“ erachtet wurde, wies die SS ins Lager ein. Wer in den Augen der SS-Führer für die vorgesehene Zwangsarbeit ungeeignet schien, Alte, Kranke, Frauen mit Kindern, wurde von der Rampe weg in die Gaskammern gebracht und mit Giftgas ermordet.
Die Deportationstransporte kamen aus Frankreich (69.000 Juden), den Niederlanden (60.000 Juden), Belgien (25.000 Juden), Deutschland/Österreich (23.000 Juden), Italien (7.500 Juden), Norwegen (690 Juden), der Slowakei (27.000 Juden), Protektorat Böhmen und Mähren/Ghetto Theresienstadt (46.000 Juden), Jugoslawien (10.000 Juden), Griechenland (55.000 Juden), Polen (300.000 Juden) und Ungarn (438.000 Juden).
Etwa 650 RSHA-Transporte mit über einer Million Juden wurden nach Auschwitz-Birkenau zur Vernichtung geleitet.
Auf der Alten Rampe am Güterbahnhof von Auschwitz, ab Mai 1944 auf der Neuen Rampe innerhalb des Vernichtungslagers Birkenau, trieben SS-Männer die Menschen aus den Waggons der Deutschen Reichsbahn und beraubten sie ihrer letzten Habe. Nach der anschließenden Selektion, zunächst durch SS-Angehörige der Lagerverwaltung, später meist durch SS-Ärzte, eskortierten die Wachmannschaften Schwache, Alte, Kranke, Kinder und Jugendliche sowie schwangere Frauen direkt in die Gaskammern.
Die Überlebenden der Selektionen, meist zwischen 15 bis 30 Prozent der Deportierten, wurden registriert. Ihnen wurden die Haare geschoren und eine Häftlingsnummer auf den linken Unterarm tätowiert, bevor sie, häufig nach einem sogenannten Quarantäneaufenthalt, auf die verschiedenen Lager, darunter das KZ Buna/Monowitz, verteilt wurden. Sie wurden Arbeitskommandos zugewiesen und hatten Zwangsarbeit, unter anderem im Werk I.G. Auschwitz, zu leisten. Waren sie physisch nicht mehr arbeitsfähig, schickte sie die SS ebenfalls ins Gas.
(WR)