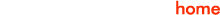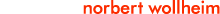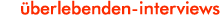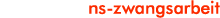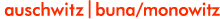Herman Sachnowitz (1922–1978)
„Und mitten in diesem Elend – ich sehe es immer noch vor mir – stieg eine schweigende Schar schwächlicher alter Frauen und Männer langsam und gesenkten Hauptes das Fallreep hoch, einem Schicksal entgegen das ihnen unausweichlich zu sein schien. Sie wussten mehr als wir Jungen. Sie kannten die Geschichte unseres Volkes. Sie hatten mit dem Leben abgeschlossen.“
(Herman Sachnowitz: Auschwitz. Ein norwegischer Jude überlebte. Geschrieben von Arnold Jacoby. Frankfurt am Main/Wien/Zürich: Büchergilde Gutenberg 1981, S. 16.)
„Gott segne euch, meine Jungen! Was nun geschieht, ist das schlimmste Ungemach, das uns je widerfahren konnte. Wir werden einander aus den Augen verlieren. Man wird uns mit Häftlingen aus anderen Ländern zusammentun, und wir werden schließlich nicht mehr wissen, wo wir sind und mit wem wir es zu tun haben. Wir werden nicht wissen, was wir glauben sollen und auf wen wir vertrauen können. Von nun an wird es kein Vorteil mehr sein, daß wir aus einem Land kommen, wo die Menschen aufgeklärt und kultiviert sind. Dies wird alles nur noch schwieriger machen. Von nun an wird jeder von uns nur eine Nummer von vielen sein. Doch einen Rat will ich euch geben: Wenn die Wachtposten euch auffordern zu laufen, so tut es nicht! Lauft niemals! Denn das ist der Tod. Ich weiß es, denn ich war schon früher in einer ähnlichen Lage, in den Militärlagern des alten Russland.“
(Herman Sachnowitz: Auschwitz. Ein norwegischer Jude überlebte. Geschrieben von Arnold Jacoby. Frankfurt am Main/Wien/Zürich: Büchergilde Gutenberg 1981, S. 23.)
(Herman Sachnowitz: Auschwitz. Ein norwegischer Jude überlebte. Geschrieben von Arnold Jacoby. Frankfurt am Main/Wien/Zürich: Büchergilde Gutenberg 1981, S. 201.)
„Ich wußte damals noch nicht, daß wir niemals dem KZ gänzlich entkommen würden, daß Stimmen, Geräusche, Bilder uns ein Leben lang foltern würden. Daß wir des Nachts uns mit Alpträumen herumschlagen müßten, daß es bittere Stunden geben würde, die schier unerträglich waren.“[1]
Herman Sachnowitz kam 1922 in Stokke, Norwegen, zur Welt. Er hatte drei Schwestern – Rita, Marie und Frida – und vier Brüder – Martin, Elias, Samuel und Frank. Seine Mutter starb, als die Kinder noch klein waren. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht im April 1940 wurde das Leben schwierig für die Familie Sachnowitz: Martin, Elias und Samuel, die älteren Brüder, wurden verhaftet und erst nach Folterungen wieder freigelassen. Als klar war, „dass wir in der Stadt kaum mehr wohnen konnten“[2], kaufte sein Vater, Israel Sachnowitz, einen Bauernhof. Am 26. Oktober 1942 wurden Israel Sachnowitz und alle fünf Söhne von norwegischen Hirdleuten verhaftet und ins Lager Berg bei Tønsberg gebracht. Die Schwestern hätten die Gelegenheit gehabt, nach Schweden zu fliehen, aber sie nahmen sie nicht wahr, so dass mit Ausnahme von Rita und Frida die ganze Familie am 26. November 1942 in Oslo auf das Deportationsschiff „M/S Donau“ gebracht wurde.
Nach vier Tagen kamen sie in Stettin an, von dort wurden sie und die übrigen deportierten 525 norwegischen Juden in Viehwaggons nach Auschwitz gebracht.
Dank der Unterstützung von Felix Pavlosky, dem Chef der Küche, erhielten die beiden Brüder bessere Kleidung und täglich eine zusätzliche Ration Brot. Nach einiger Zeit kamen sie auch in bessere Arbeitskommandos, Frank zu den Schlossern und Herman zu den Schreinern. Frank Sachnowitz wurde von seinem Kapo jedoch jeden Tag gequält und verprügelt. Am 15. Mai 1943 musste Herman ihn in den Krankenbau bringen, Frank wurde weggebracht und im August im KZ Natzweiler-Struthof vergast. Im August 1943 wurde Herman als Trompeter in die Lagerkapelle aufgenommen und kam später zum Gemüseanbau ins „Gärtnereikommando“. Beim Todesmarsch im Januar 1945 gelangte Herman Sachnowitz über Gleiwitz ins KZ Mittelbau-Dora. Kurz vor dem Verhungern, wurde er auch hier in die Lagerkapelle aufgenommen. Anfang April, nach der „Evakuierung“ von Mittelbau-Dora, wurden die Häftlinge ins KZ Bergen-Belsen getrieben. Dort wurde Herman Sachnowitz am 15. April von der britischen Armee befreit.
Er gelangte mit einem LKW, der ehemalige Häftlinge aus Deutschland herausbringen sollte, nach Holland. Über Dänemark kam er schließlich am Bahnhof in Larvik an, wo ihn viele Freunde und sein leeres, ausgeplündertes Elternhaus erwarteten. Er gründete eine Familie mit Paula. 1976 erschien Herman Sachnowitz‘ Überlebensbericht Det angår også deg (dt. Ein norwegischer Jude überlebte, 1981). Differenziert und eindringlich vollzieht die Leserin den Übergang aus dem glücklichen Leben einer großen Familie in Verlust, Schrecken und Unmenschlichkeit nach, in eine „Wirklichkeit, die schlimmer als ein Alptraum war“[3]. Die schrittweise Entwürdigung, allgegenwärtige Angst werden in großer Detailliertheit und Reflektiertheit geschildert, deutlich aus der Nachkriegsperspektive, aber eindrucksvoll im Versuch, die Zeit der Lagerhaft erzählerisch zu vergegenwärtigen. Herman Sachnowitz starb 1978.
(SP)