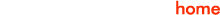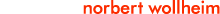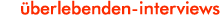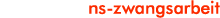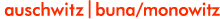Der Bericht Durch die Hölle. Monowitz, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald von Willy Berler (2003)
Willy Berler berichtet mehr als 55 Jahre nach seiner Befreiung über seine Gefangenschaft in den Konzentrationslagern des NS-Regimes. Mit seinem Buch will er die „ungeheuerliche Ungerechtigkeit“[1] bezeugen, die den Konzentrationslagerhäftlingen angetan wurde und Anklage gegen deren Peiniger erheben. Auch gegen diejenigen, die heute versuchen, den Holocaust zu relativieren und zu leugnen.
In Zusammenarbeit mit der Historikerin Ruth Fivaz-Silvermann hat Willy Berler ein Buch geschrieben, das zu großen Teilen aus autobiographischen Elementen besteht. Ruth Fivaz-Silvermann hat zu verschiedenen Themen und Schlagwörtern jeweils kurze, separat gesetzte Texte mit Hintergrundinformationen verfasst und Willy Berlers Bericht um Annotationen und Quellenverweise ergänzt.
Insgesamt ist das Buch in einer schlichten Sprache gehalten, die sehr gut zu dem Anliegen des Buches – zu berichten – passt. Hierdurch wird den Leser/innen ermöglicht, „das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager exemplarisch – ausgenommen die Tatsache seines [Willy Berlers] Überlebens – zu erkennen“[2] wie Simon Wiesenthal im Vorwort schreibt. Willy Berler beschreibt das Erlebte aus der Ich-Perspektive, bedient sich allerdings des Präsens, was sehr ungewöhnlich ist. Durch diese zeitliche Perspektive wird das Beschriebene sehr konkret und anschaulich, eine Emotionalisierung wird allerdings durch die nüchterne Sprache und Wortwahl vermieden. Exemplarisch hierfür ist Willy Berlers Erzählung von seiner „Überstellung“ aus dem KZ Buna/Monowitz nach Auschwitz. Nicht viel mehr als ein „Muselmann“ ist er nach der Zwangsarbeit für I.G. Farben und wartet auf den SS-Arzt zur Aufnahme im Krankenbau:
„Ich weiss, dass ich nach der Dusche nackt im Korridor auf die Ankunft des SS-Arztes warten muss. Dieser wünscht, den halbverfaulten Häftlingskörpern nicht allzu nahe zu kommen. Das Krankenrevier ist, wie gesagt, nicht zum Pflegen und Heilen der Menschen da, es ist vielmehr ein unsicheres Terrain. Der SS-Arzt handelt auch nicht wie ein normaler Arzt. Aber schließlich ist diese Welt auch keine normale, menschliche Welt, und wir stecken bis zum Hals darin und versuchen, nicht unterzugehen.“[3]
Hier lässt sich sehr gut der beschreibende und zugleich analysierende Stil erkennen, der die Leser/innen manchmal verunsichern kann und wohl daher rührt, dass man zwar durch die Verwendung des Präsens in die Nähe des Geschehens gerückt wird, der Autor aber aus einem großen zeitlichen und emotionalen Abstand beschreibt. So werden Leid, und Gefühle wie Hass und Angst, zu einem Teil der Betrachtung, man fühlt sie nicht während des Lesens.
Berlers Bericht bietet eine sehr detaillierte Beschreibung des Häftlingsalltags, der Solidarität unter Häftlingen, des Verhaltens der SS und der Funktionshäftlinge und teilweise der „administrativen Maßnahme[n]“[4] in den Konzentrationslagern. Es ist die Beschreibung eines jungen Mannes, der seine Situation zu seinem Vorteil schnell und nüchtern erkannt hat, diese Situation der „Entwürdigung des Todes“, in der der „Bettnachbar, der während der Nacht krepiert“ und der „Arbeitskamerad, der vom wütenden Kapo zusammengeschlagen wird“, keine Menschen mehr sind, sondern „nur starre Leichname, die wie Brennholz entlang der Straße zum Krematorium aufgestapelt werden“.[5] „Alles ist hier vorbestimmt, alles endet im Kamin des Krematoriums.“[6] Dieser Hinweis auf die Determiniertheit des Häftlingslebens illustriert ein Denken, das sicher exemplarisch für viele Häftlinge war.
Die Nüchternheit der Beschreibung steht im Gegensatz zu vielen anderen Überlebendenberichten, und sie mag den Leser/innen ungewohnt vorkommen, allerdings gewinnt man so Zugang zu einer (anderen, vielleicht eher) historisch-kontextualisierenden Betrachtungsweise des Berichteten. Simon Wiesenthal sieht darin ein geradezu pädagogisches Prinzip – und er hat sicher recht.
(LG)