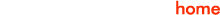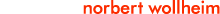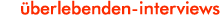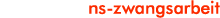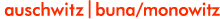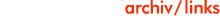Die Autobiographie Der grauende Morgen von Imo Moszkowicz (1998)
(Imo Moszkowicz: Der grauende Morgen. Eine Autobiographie. München: Knaur 1998, S. 27.)
(Imo Moszkowicz: Der grauende Morgen. Eine Autobiographie. München: Knaur 1998, S. 111–12.)
(Imo Moszkowicz: Der grauende Morgen. Eine Autobiographie. München: Knaur 1998, S. 48–49.)
„Wartend war es beinahe schon Abend geworden, und ich dachte, dass ich wohl dort, wo die Holländer sich angestellt hatten, nicht ganz verkehrt sein könnte. Ich verstehe, da ich Plattdütsch verstehe, bestimmt ihre Sprache, und außerdem ist Westfalen an Holland grenzend; ergo stimmte die generelle Richtung, in die es mich jetzt zog. Ich hatte eine eigene Entscheidung getroffen, die damit verbundenen Folgen abwägend, die mir nicht mehr gefährlich sein konnten. Mir wurde langsam klar, dass ich mich jetzt in einem Zustand der Unantastbarkeit bewegte, der mit frei sein zu tun hatte. Mir war wie einem Tier zumute, das plötzlich keine Gitter mehr um sich hat und keine Dressurpeitsche mehr zu spüren bekommt. Ich tappste an einem sonnigen Tag durch diese Welt, genoss seine Wärme, tief atmend. War das die Freiheit? Meine Gefühle waren für den Moment nicht dahingehend zu kultivieren, da ich die letzten Tage wie in einem Dämmerzustand verbracht hatte, die Umgebung nicht wahrnehmend. Und dieses Betäubtsein begleitete mich noch lange, immer wieder von dem Wunsch durchbrochen zu erkennen, was mit mir eigentlich los ist. Warum jubelte ich nicht? Warum sprang ich nicht in die Lüfte, abhebend wie ein freier Vogel? Ich weiß es bis heute nicht. Ich wusste nur, dass ich allein war und mich an gar nichts mehr klammem konnte.“
(Imo Moszkowicz: Der grauende Morgen. Eine Autobiographie. München: Knaur 1998, S. 196.)
Imo Moszkowicz kam 1942 mit 17 Jahren ins KZ Buna/Monowitz. Über 50 Jahre später erzählt er in seiner Autobiographie von der immer wiederkehrenden Vergangenheit, die sich nie ganz betäuben lässt. Er erzählt nicht historisch-chronologisch, sondern macht seine eigenen Assoziationen und Gefühle zu den Ausgangspunkten des Textes und erlaubt so einen sehr persönlichen, informellen Zugang zu seinen Erinnerungen und seinem Umgang mit ihnen. Diese Nähe wird durch die Perspektive des sich erinnernden Erzählers hergestellt, der während seines Lebens als Schauspieler und Regisseur in der Nachkriegszeit „süchtig auf dieses Vergessenkönnen“[1] war, ohne sich dem Erlebten entziehen zu können. Das erlebte Leid, der von Todesahnung erfüllte Schrei seiner Mutter, aber auch das feixende Zuschauen der Essener Bevölkerung bei der Deportation lassen ihm alle Versuche des Nachkriegstheaters, Leid darzustellen, nur lachhaft erscheinen. Ein Schauspieler, der wegen des Schreis einer Figur in echte Tränen ausbreche, sei nur Signal einer Darstellung, die Realität nie nachzuempfinden vermag. In Bahnhöfen martern ihn die Erinnerungen.
Der Text folgt einer Ordnung die den Autor vor dem Unerträglichen schützt, indem sie immer wieder die Zeit nach der Befreiung und die Gegenwart zu einem Bestandteil des Textes macht und so den Blick in die Erinnerungen dem Positiven nicht verschließt. Der Einsatz von verschiedenen Sprachebenen ermöglicht einen komplexen Zugang zum Gehalt des Textes, da das subjektiv Empfundene meist metaphorisch, damit sehr bildhaft ausgedrückt wird, während Simplizität und umgangssprachliche Wortwahl verwendet wird, wenn sich das Dasein im Lager, das Verhalten der SS, einer komplexeren Ausdrucksweise verschließt.
Schon lange vor der Deportation ins Lager fühlte Imo Moszkowicz, was es bedeutet, einem „Volkeswillen“ ausgesetzt zu sein, der sich an der eigenen beschämenden Situation „mit der Fratze des Hasses weidete“[2]. Eine Kindheit, in der immer die Frage nach dem „Warum?“ dämmerte. Fragen, die im Lager immer wieder erneut hervorbrechen, ohne eine echte Antwort zu ermöglichen, wohl wissend wie absurd die Frage an diesem Ort war. „Warum? War ich anders als andere Kinder? Waren meine Eltern, meine sechs Geschwister, die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde, Verbrecher? Was hatten sie getan? Christus ermordet, Hitler nicht gewollt?“[3] Eine Antwort konnte Imo Moszkowicz bis heute nicht finden, es bleibt ihm nur die Erkenntnis, „den Hass als alles zerstörendes Prinzip zu erkennen und […] dass nur ein Leben ohne Hass wirkliches Leben ist.“ [4]
Das Dasein im Lager erscheint als eine Frist ohne Gnade. „Der Tod war beschlossen, und der Aufschub hatte nichts mehr mit dem zu tun, was man gemeinhin Leben nennt.“[5]
Die Befreiung ist für Imo Moszkowicz nur eine physische, denn „[d]as Gefühl frei zu sein, stellte sich nicht ein, viel eher schon eine Art Angst, von einem merkwürdigen Gefühl des plötzlichen Verlassenseins diktiert.“[9] Als er den elenden Zug der gebeugten und gedemütigten Kriegsgefangenen, die „primitiven Vogelscheuchen“ gleichen, durch das befreite Liberec ziehen sieht, kann er kein Rachegefühl in sich spüren, er „spürte die Verzweiflung der Gefangenen“ und ihm „war übel“.[10]
Bei dem Versuch, sich an die Zeit, bevor er nach Auschwitz kam, zu erinnern, beginnt sich sein Erinnerungsvermögen zu sperren. Sein Unterbewusstsein wird zum Selbstschutz, signalisiert ihm, dass er „…der brutalen Wahrheit nicht in die grinsende Fratze sehen sollte.“[11] Es ist die Wahrheit, dass seine Familie ermordet wurde. Dass es keine göttliche Rache für das Geschehene gibt, dass „der blassgesichtige Todesengel“[12] Unterscharführer Sommer als Gelähmter, nach versuchtem Suizid im Gerichtssaal Menschlichkeit erfährt, die es in den Gerichtssälen des nationalsozialistischen Deutschland nicht gab. Die Wahrheit, die so unerträglich ist, dass er nicht in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen aussagt, unfähig die psychische Belastung zu ertragen, wie er in einem Brief an die Staatsanwaltschaft schrieb.
(LG)