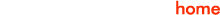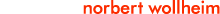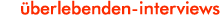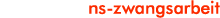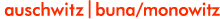Überlebende des KZ Buna/Monowitz als Zeugen im I.G. Farben-Prozess
Im Prozess Vereinigte Staaten gegen I.G. Farben benannten sowohl die Anklagevertretung als auch die Verteidigung Überlebende des KZ Buna/Monowitz als Zeugen. Bei den in der Hauptverhandlung (14. August 1947 bis 30. Juli 1948) vernommenen 19 Buna/Monowitz-Überlebenden handelte es sich um 16 Zeugen der Anklage und drei Zeugen der Verteidigung. Grundlage der Vernehmung eines Zeugen war die eidesstattliche Erklärung (Affidavit), die entweder die Anklagevertretung oder die Verteidigung als Beweisstück vorgelegt hatte.
Die Vernehmung der Opferzeugen verlief nach festen prozessualen Regeln. Zeugen der Anklage wurden zunächst von den amerikanischen Anklagevertretern gefragt, ob sie an ihrem Affidavit Korrekturen bzw. Ergänzungen vornehmen wollten. In wenigen Fällen wurde der Zeuge durch die Anklagebehörde in ein „direktes Verhör“ („direct examination“) genommen. Sodann hatten die Verteidiger der Angeklagten die Möglichkeit, auf der Basis der eidesstattlichen Versicherung des Zeugen diesen ins „Kreuzverhör“ („cross-examination“) zu nehmen.
Die Strategie der Verteidigung war durchweg, die in den Affidavits gemachten Aussagen zu dekonstruieren, sie in ihrer Beweiskraft zu relativieren. Die Mitverantwortung der I.G. an den im KZ Buna/Monowitz und auf dem I.G.-Werksgelände begangenen Verbrechen wurde beharrlich bestritten, eine funktionelle Ohnmacht der I.G. gegenüber der SS betont. Hatten die Opferzeugen in ihren Affidavits Zahlenangaben über die Lagerstärke, den Krankenstand, die Aufenthaltsdauer im Häftlingskrankenbau, über Selektionen etc. gemacht, versuchte die Verteidigung unter Vorhalt widersprechender oder abweichender Aussagen und Dokumente, die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage zu stellen. Unter den von der Anklagebehörde geladenen Zeugen waren insgesamt sieben „alte“ Häftlinge, die zu den ersten Insassen des Konzentrationslagers Buna/Monowitz gehört hatten. Es handelte sich mithin um Überlebende, die die Geschichte des Lagers gut kannten und die durch ihre Funktionsstellung (Gustav Herzog war u.a. „Rapportschreiber“, Bertold Epstein war Häftlingsarzt, Felix Rausch war Häftlingsschreiber im Häftlingskrankenbau, Ervin Schulhof war Häftlingsschreiber in der Abt. Arbeitseinsatz) über das Geschehen im Lager genaue Angaben machen konnten. Andere Zeugen wie Norbert Wollheim, Isaac Spetter, Jan Stern, Arnest Tauber und Noack Treister waren zur Sklavenarbeit in den Arbeitskommandos auf dem I.G.-Werksgelände gezwungen worden und schilderten im Einzelnen das Verhalten der I.G.-Meister und leitender Angestellter wie Walther Dürrfeld und Max Faust.
Die drei Zeugen der Verteidigung erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen nur teilweise. Der „kriminelle Häftling“ Fritz Schermuly, 1897 in München geboren, im April 1943 vom Mauthausener Nebenlager Gusen in das KZ Buna/Monowitz verbracht, hatte in seinem Affidavit bekundet, dass er und andere I.G.-Zwangsarbeiter sich durch die vergleichsweise gute Verpflegung in Buna/Monowitz körperlich erholt hätten und dass Dr. Walther Dürrfeld „unter den Häftlingen als Helfer bekannt“[1] gewesen sei. Die Anklagebehörde beschränkte sich in ihrem Kreuzverhör darauf, die nicht gerade kurze kriminelle Karriere des Entlastungszeugen aufzuzeigen. Auch der Zeuge Martin Nestler konnte auf ein umfassendes Strafregister zurückblicken. Bis zum Jahr 1933 war er, wie ihm die Anklagevertretung im Kreuzverhör vorhielt, allein in elf Fällen verurteilt worden, meist wegen Betrugs. Nestler malte im direkten Verhör durch Rechtsanwalt Dr. Seidl, Verteidiger des Angeklagten Dr. Walther Dürrfeld, das Lager Buna/Monowitz in den schönsten Farben. Die Verpflegung sei sehr gut gewesen, jeder Häftling habe sein eigenes meist mit Steppdecken ausgestattetes Bett gehabt. Von Übergriffen auf dem Werksgelände wusste Nestler nur zu berichten, dass SS und Kapos, nicht aber Zivilisten, Häftlinge geschlagen hätten. Von Selektionen habe er erst nach seiner Befreiung gehört.
Der jüdische Überlebende Adolf Taub,[2] dessen Mutter und Schwester in Auschwitz ermordet wurden, bestätigte im Kreuzverhör, was Zeugen der Anklage bekundet hatten: das Wissen der Manager um Vergasungen in Birkenau, die vielen Toten in bestimmten Kommandos, die miserable Qualität der Buna-Suppe.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Versuch der Verteidigung, das KZ Buna/Monowitz als normales Arbeitslager, die Arbeit auf dem Werksgelände als geregelte und wenig anstrengende Tätigkeit sowie die Alleinverantwortung der SS unter Beweis zu stellen, auf Grund der Aussagen der Überlebenden und der erdrückenden Beweislast der von der Anklagevertretung vorgelegten Dokumente fehlschlug. Das amerikanische Militärgericht kam deshalb im Urteil zu folgender Erkenntnis: „Die von dem Konzentrationslager Auschwitz zur Verfügung gestellten Arbeiter lebten und arbeiteten“ in I.G. Auschwitz „unter dem Schatten der Liquidierung.“[3]
(WR)