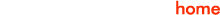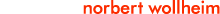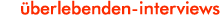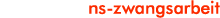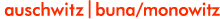Der autobiografische Roman Se questo è un uomo von Primo Levi (1958)
(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 21.)
(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 36–37.)
(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 28.)
(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 127.)
(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 79–80.)
(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 145.)
„Ebenso wie unser Hunger nicht mit der Empfindung dessen zu vergleichen ist, der eine Mahlzeit verloren hat, verlangt auch unsere Art zu frieren nach einem eigenen Namen. Wir sagen ‚Hunger‘, wir sagen ‚Müdigkeit‘, ‚Angst‘ und ‚Schmerz‘, wir sagen ‚Winter‘, und das sind andere Dinge. Denn es sind freie Worte, geschaffen und benutzt von freien Menschen, die Freud und Leid in ihrem Zuhause erlebten. Hätten die Lager länger bestanden, wäre eine neue, harte Sprache geboren worden; man braucht sie einfach, um erklären zu können, was das ist, sich den ganzen Tag abzuschinden in Wind und Frost, nur mit Hemd, Unterhose, leinener Jacke und Hose am Leib, und in sich Schwäche und Hunger und das Bewußtsein des nahenden Endes.“[1]
In seinem autobiografischen Roman Se questo è un uomo (dt. Ist das ein Mensch?, 1961) beschreibt der italienische Überlebende Primo Levi seine Lagerhaft im KZ Buna/Monowitz. Beginnend mit seiner Verhaftung durch die faschistische Miliz im Dezember 1943 folgt der Text Primo Levis Erleben der darauffolgenden zwölf Monate Haft im nationalsozialistischen KZ Buna/Monowitz, sieben Kilometer östlich von Auschwitz. Mit seiner Ankunft im Lager betritt der Ich-Erzähler Primo Levi, promovierter Chemiker, eine Welt, an der im Folgenden seine Sprache versagt; nur mittels literarischer Bezüge auf Dantes Inferno vermag er, sie zu umreißen.
Den Tagesablauf, Schwerstarbeit und Misshandlungen durch Häftlingsfunktionäre und SS-Männer, die zahllosen Schikanen bis in jeden Bereich des Lebens, die Selbstverständlichkeiten negieren, beschreibt Primo Levi genau und nachdenklich. Seine präzise Schilderung einzelner Begebenheiten und Routinen macht Sinnlosigkeit und Grausamkeit, die das Lager und den Umgang der Häftlinge miteinander prägen, erahnbar – und bezeichnet die Entfernung des ‚Lagers‘ von einer parallel existierenden ‚Normalität‘. Das Lager führt ihn, in Dantes Worten, „In die Tiefe“, in eine Hölle. Primo Levi denkt – ausdrücklich aus der Nachkriegsperspektive, von einem „wirklichen Heute“[2] aus – mögliche Interpretationen
Ist das ein Mensch? erhält seinen Titel von einem gleichnamigen Gedicht Primo Levis, das vehement das Gedenken an die unmenschlichen deutschen Konzentrationslager, an Auschwitz, einfordert. Primo Levi selbst schrieb das Buch, sein erster literarischer und sein zweiter Text über Auschwitz, nach einem Bericht über die medizinischen Verhältnisse im KZ Buna/Monowitz, aus dem Bestreben, „Zeugnis abzulegen und […] denjenigen, die den Letzten erhängten, und ihren Erben zu ‚antworten‘“[5]. Er wirft dabei wesentliche Fragen nach der Möglichkeit, das Unvorstellbare zu bezeugen, auf. 30 Jahre später kam Primo Levi explizit auf diese Fragen zurück, in I sommersi e i salvati (1986, dt. Die Untergegangen und die Geretteten, 1990) formuliert er:
„Nicht wir, die Überlebenden, sind die wirklichen Zeugen. Das ist eine unbequeme Einsicht, die mir langsam bewußt geworden ist, während ich die Erinnerungen anderer las und meine eigenen nach einem Abstand von Jahren wiedergelesen habe. Wir Überlebenden sind nicht nur eine verschwindend kleine, sondern auch eine anomale Minderheit: wir sind die, die aufgrund von Pflichtverletzung, aufgrund ihrer Geschicklichkeit oder ihres Glücks den tiefsten Punkt des Abgrunds nicht berührt haben.“[6]
Ist das ein Mensch? kann als Ausgangspunkt und Referenztext für Levis gesamte schriftstellerische Arbeit gesehen werden und diente, wie die literarisierten Überlebensberichte etwa Jean Amérys oder Elie Wiesels, als Referenz zahlreicher Interpretationen und kulturwissenschaftlicher wie philosophischer Überlegungen.
Se questo è un uomoerschien 1947 erstmals bei De Silva, eine nennenswerte Verbreitung erfuhr jedoch erst die zweite Auflage, die mit Erweiterungen 1958 bei Einaudi herauskam und Grundlage der zahlreichen Übersetzungen in viele Sprachen ist.
(SP)