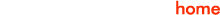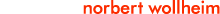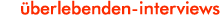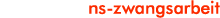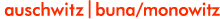Primo Levi (1919–1987)
(Primo Levi: Die Untergegangenen und die Geretteten. München/Wien: Hanser 1991, S. 153.)
„[D]as ist gerade das Charakteristikum des nazistischen Lagers – von den anderen weiß ich es nicht, weil ich sie nicht kenne, vielleicht ist es in den russischen genauso –, daß es die Persönlichkeit des Menschen innerlich wie äußerlich vernichtet, und nicht nur die des Häftlings; auch der Aufseher verliert im Lager seine Menschlichkeit.“[1]
Primo Levi wurde am 31. Juli 1919 in Turin geboren. Nachdem das faschistische Italien 1938 Rassegesetze nach nationalsozialistischem Vorbild proklamiert hatte, schloss er sich einer antifaschistischen Studentengruppe an. Primo Levi studierte Chemie an der Universität Turin und schloss das Studium im Juli 1941 mit der Promotion ab. Er begann, im chemischen Labor einer Asbestmine zu arbeiten, und unterstützte seine Familie und besonders seinen krebskranken Vater finanziell. 1942 wechselte Levi zu einem schweizerischen Pharmakonzern in die Diabetes-Forschung nach Mailand.
Im Herbst 1943 ging Primo Levi „in die Berge“, um sich einer antifaschistischen Partisanengruppe anzuschließen. Am 13. Dezember wurde er jedoch von der faschistischen Miliz verhaftet und im Januar 1944 in das Konzentrationslager Carpi-Fossoli gebracht. Von dort deportierte ihn die SS gemeinsam mit 650 Frauen, Männern und Kindern nach Auschwitz. Bei der Ankunft wurde er zur Zwangsarbeit im KZ Buna/Monowitz bestimmt.
Im Lager musste er zunächst mehrere Monate in Transport- und Erdarbeitkommandos arbeiten, bis er im November 1944 dem „Chemiker-Kommando“ zugeteilt wurde. Fortan konnte er in einem wettergeschützten Labor arbeiten und hatte eine Chance, den polnischen Winter zu überstehen. Im Januar 1945 erkrankte Levi an Scharlach und musste sich im Häftlingskrankenbau melden. Als die SS die Häftlinge am 18. Januar auf den Todesmarsch trieb, blieben nur die Kranken zurück. Primo Levi erlebte mit den wenigen Überlebenden von Krankheit, Hunger und fehlender Pflege die Befreiung des KZ Buna/Monowitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945. Er kam zunächst in ein Notaufnahmelager in Katowice, bis er im Juni 1945 seine lange Reise zurück nach Italien begann. Der Weg führte ihn durch die Ukraine nach Rumänien, Ungarn und Österreich, bis er am 19. Oktober 1945 Turin erreichte. Diese Odyssee bildete später die Grundlage für Levis autobiographischen Roman La tregua (1963; dt. Die Atempause, 1964).
Levi wandte sich wieder der Chemie zu und fing als Laborchemiker in der kleinen Farbenfabrik Siva an. Schon wenige Jahre später avancierte er hier zum Direktor. Mitte der fünfziger Jahre legte das renommierte Verlagshaus Einaudi Primo Levis Überlebensbericht Se questo è un uomo (1946/1958; dt. Ist das ein Mensch?, 1961) mit großem Erfolg neu auf.
(SP)