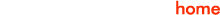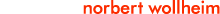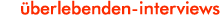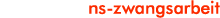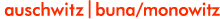Widerstand
(Herman Sachnowitz: Auschwitz. Ein norwegischer Jude überlebte. Geschrieben von Arnold Jacoby. Frankfurt am Main/Wien/Zürich: Büchergilde Gutenberg 1981, S. 108.)
(Ya’acov Silberstein, Lebensgeschichtliches Interview [Hebr.], 29./30.7.2007. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Norbert Wollheim Memorial, Min. 19:06 ff. (Übers. MN))
(Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz. Frankfurt am Main: Fischer 1961, S. 60.)
(Ya’acov Silberstein, Lebensgeschichtliches Interview [Hebr.], 29./30.7.2007. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Norbert Wollheim Memorial. (Übers. MN))
(Fritz Kleinmann: Überleben im KZ. In: Reinhold Gärtner / Fritz Kleinmann (Hg.): Doch der Hund will nicht krepieren… Tagebuchnotizen aus Auschwitz. Thaur: Kulturverlag 1995, S. 34–114, hier S. 98.)
(Oszkár Betlen: Leben auf dem Acker des Todes. Berlin: Dietz 1962, S. 128.)
(Leon Staischak [Stasiak], Eidesstattliche Erklärung, 3.9.1947, NI-10928. Archiv des Fritz Bauer Instituts, Nürnberger Nachfolgeprozess Fall VI, ADB 75 (d), Bl. 208–218, hier Bl. 211.)
(Dr. Heinz Kahn: Erlebnisse eines jungen deutschen Juden in Hermeskeil, Trier, Auschwitz und Buchenwald in den Jahren 1933 bis 1945. In: Johannes Mötsch (Hg.): Ein Eifler für Rheinland-Pfalz. Festschrift für Franz-Josef Heyen. Mainz: Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte 2003, S. 641–659, hier S. 655.)
(Jean Améry: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Stuttgart: Klett-Cotta 1997, S. 34.)
(Dr. Heinz Kahn: Erlebnisse eines jungen deutschen Juden in Hermeskeil, Trier, Auschwitz und Buchenwald in den Jahren 1933 bis 1945. In: Johannes Mötsch (Hg.): Ein Eifler für Rheinland-Pfalz. Festschrift für Franz-Josef Heyen. Mainz: Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte 2003, S. 641–659, hier S. 655.)
(Oszkár Betlen: Leben auf dem Acker des Todes. Berlin: Dietz 1962, S. 170–171.)
„Wer nicht resignierte und die Kraft hatte, den Verhältnissen im Lager zu trotzen, zeigte allein dadurch schon Widerstand. Wer vom Tod seiner Liebsten in den Gaskammern erfuhr und dann noch den Willen besaß, das tägliche Martyrium auf sich zu nehmen, leistete ebenso eine bestimmte Form von Widerstand.“[1]
Konzentrationslager-Häftlinge leisteten Widerstand gegen die SS und die Lagerbedingungen auf verschiedene Art und Weise; zu unterscheiden ist zwischen ‚alltäglichem‘ und ‚organisiertem‘ Widerstand. Im Alltag eines Konzentrationslagerhäftlings muss gegenseitige Hilfe bereits als Akt des Widerstands gegen das System des KZ gewertet werden. Das Ausüben von alltäglich-menschlichen, kulturellen oder religiösen Handlungen erforderte Kraft, welche die ausgemergelten Häftlinge oft nicht aufbringen konnten. Dennoch berichteten Häftlinge des KZ Buna/Monowitz von improvisierten Jahrestagfeiern
Einer kleinen Anzahl von Häftlingen gelang es, auch trotz dieser und weiterer Schwierigkeiten, etwa strengste Bewachung und geringe Kontaktmöglichkeiten zur Außenwelt, organisierten Widerstand zu leisten. Die meisten von ihnen hatten bereits lange Lagererfahrung seit 1938 und schon früher im Geheimen und straffen Organisationsformen gearbeitet.
Die ersten, die organisierte Widerstandsaktionen durchführten, waren polnische Nationalisten und Militärs, die im Stammlager inhaftiert waren. Ein Ableger der dort 1940 von Witold Pilecki gegründeten militärischen Widerstandsgruppe (Związek Organizacji Wojskowych, ZOW) bestand auch im KZ Buna/Monowitz unter Kazimierz Gilewicz. Die dortige Zelle wurde jedoch im Juni 1943 von der Gestapo aufgedeckt und stark geschwächt. Sowjetische Kriegsgefangene unter Major Aleksandr Lebedev hatten eine Gruppierung gegründet, die zunächst in Birkenau, später auch in Buna/Monowitz agierte. Daneben existierte im Stammlager die linksorientierte „Kampfgruppe“ von Jozef Cyrankiewicz, Hermann Langbein, Tadeusz Holuj und Ernst Burger. Alle vier schlossen sich 1944 zum Militärrat zusammen.
Mit der Gründung des Lagers Buna/Monowitz im Oktober 1942 gelangten dorthin auch zahlreiche Kommunisten, insbesondere aus Sachsenhausen und Buchenwald, u.a. die Deutschen Curt Posener, Stefan Heymann, die Österreicher Gustav Herzog und Felix Rausch, der Pole Leon Stasiak, der Tscheche Ervin Schulhof und Oszkár Betlen aus Ungarn. Die Ziele dieser kommunistischen Zelle im Rahmen der geringen Möglichkeiten in einem Konzentrationslager fasste Curt Posener folgendermaßen zusammen:
„1. Rettung von möglichst vielen Menschenleben
2. Genaue Kontrolle der von der SS bzw. der Werksleitung herausgegebenen Befehle und Anordnungen.
3. Die Hinauszögerung der Fertigstellung der Bauten und Projekte der Buna.
4. Schulung Jugendlicher.
5. Aufnahme von Verbindungen zu Zivilisten, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen.
6. Beschaffung von Lebensmitteln und Materialien zur Verbesserung der Lage der Häftlinge.“[2]
Der kommunistische Widerstand darf als der aktivste und straffest organisierte im KZ Buna/Monowitz gelten.
Darüber hinaus leisteten weitere, wenn auch kleinere Gruppen Widerstand, etwa organisierte Zionisten oder religiöse Juden.
(SP)