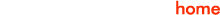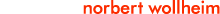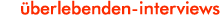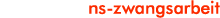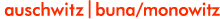Elie Wiesels Schriften
(Elie Wiesel: All Rivers Run to the Sea. Memoirs, Vol. One 1928–1969. London: HarperCollins 1996, S. 402.)
(Elie Wiesel: Legends of Our Time. New York: Avon 1970, S. VIII.)
Elie Wiesels Schriften und ihre Rezeption sind so umfangreich, dass hier nur auf einige hingewiesen und ausgehend von seinem Zeugenbericht La Nuit (1958, dt. Nacht, 1962) nur auf ausgewählte Aspekte in weiteren Texten genauer eingegangen werden kann. Zu Wiesels Schriften zählen journalistische Arbeiten, autobiographische Texte, Romane, Theaterstücke, wissenschaftliche Arbeiten zu Themen der jüdischen Tradition und zahlreiche Essais. Die Erfahrung, des Holocaust ist die Grundlage seiner Schriften. Die Frage nach der Bedeutung dieser Erfahrung für die jeweilige Gegenwart seines Schreibens findet ihren Niederschlag in vielen seiner Romane und Essais, bis hin zur Auseinandersetzung mit seiner Bedeutung für die Generation der Kinder von Holocaust-Überlebenden in den Romanen Le cinquième fils (1983, dt. Der fünfte Sohn, 1985) und L'oublié (1989, dt. Der Vergessene, 1990). In den 1960er bis 1980er Jahren beschäftigte sich Wiesel auch mit der Lage der sowjetischen Juden, so in Les Juifs du silence (1966, dt. Die Juden in der UdSSR. Antisemitismus im Sowjet-Reich, 1967) und in dem Theaterstück Zalmen ou la folie de Dieu (1968, dt. Salmen, 1971).
In vielen seiner Texte lässt sich eine fortdauernde Auseinandersetzung mit den religiösen Traditionen und Lehren des Chassidismus, in denen er aufwuchs und von denen er tief geprägt wurde, beobachten. Im ersten Teil seiner Autobiographie, Tous les fleuves vont à la mer (1994, dt. Alle Flüsse fließen ins Meer, 1996), bezeichnet Elie Wiesel sich selbst, auch für die Nachkriegszeit, als Wischnitzer Chassid.
In der französischen Originalausgabe von Nacht – bis auf sein erstes Buch schrieb und schreibt Wiesel alle seine Bücher auf Französisch – wird dieses als témoignage (Zeugnis) bezeichnet, die deutsche Übersetzung nennt es im Untertitel Erinnerung und Zeugnis. Dennoch wurde in der Rezeption immer wieder danach gefragt, inwieweit dieses am weitesten verbreitete Buch Wiesels, das in den USA der meistgelesene Bericht eines Überlebenden ist, nicht als Roman (novel) zu lesen sei. Dagegen hat Wiesel immer klar Einspruch erhoben[1] – obgleich Nacht auch als Trilogie mit zwei Romanen veröffentlicht wurde. Seine erzählenden Texte, die sich auch als Denkbilder verstehen lassen, bieten den Leser/innen eine andere, offene Gedanken provozierende Möglichkeit, über historische Geschehnisse, in diesem Fall den Holocaust, und die durch sie aufgeworfenen Fragen das (Zusammen)Leben der Menschen betreffend nachzudenken, als ein auf dokumentierende Genauigkeit beschränktes historisches Schreiben oder ein wissenschaftliches Argumentieren. Eine solche Konzeption der Erzählung kann in der Tradition jüdischer religiöser Überlieferung gesehen werden, und so verwundert es nicht, dass Wiesel an mehreren Stellen seines Werks der Frage nach der Wahrheit in seinen Erzählungen, bzw. nach ihrer historischen Genauigkeit, mit einer ‚chassidischen Erzählung‘ begegnet.
Elie Wiesels zentraler Text Nacht lässt sich als literarische Gestaltung seines Zeugenberichts oder auch im Rahmen einer Trilogie mit zwei Romanen, La Nuit… L’Aube. Le Jour, lesen. Nacht erscheint so als Teil einer Auseinandersetzung Elie Wiesels mit seinem Dasein als Holocaust-Überlebender Ende der 1950er Jahre und mit den dadurch aufgeworfenen existentiellen Fragen im Mittel erzählenden Schreibens. Doch lässt sich Nacht auch damit vergleichen, wie Wiesel in seiner Autobiographie über seine Lagerzeit schreibt. Deutlich zeigt sich, wie der Schriftsteller Elie Wiesel aus seinem jeweiligen Schreibort und -alter heraus seiner Erinnerung an die Zeit in Auschwitz eine andere Gestaltung und neue Schwerpunkte der Darstellung, des Zugangs zu seiner Erinnerung gibt.
(MN)