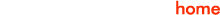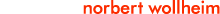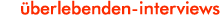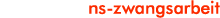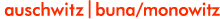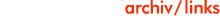Lebens- und Arbeitsbedingungen der Zwangsarbeiter/innen
Die Bedingungen, unter denen die ausländischen Zwangsarbeiter/innen im Deutschen Reich und den besetzten Ländern arbeiten und leben mussten, waren von großen Unterschieden geprägt. Das betraf Bezahlung, Unterbringung und Lebensmittelversorgung. Facharbeiter/innen in der Industrie oder Landarbeiter/innen in Familienbetrieben waren in den meisten Fällen besser gestellt als Arbeiter/innen in Zwangsarbeiterlagern oder Konzentrationslagern.
In den ersten Kriegsjahren wurden ausländischen Arbeiter/innen oft die gleichen Essensrationen zugesprochen wie Deutschen; Erlasse des Reichsarbeitsministeriums regelten Rechte und Pflichten der Arbeiter/innen, garantierten etwa auch die Befristung der Arbeitsverhältnisse und die Rückkehr der ‚Fremdarbeiter/innen‘. Nichtsdestotrotz standen beispielsweise auf Vergehen gegen das Gesetz höhere Strafen als bei Deutschen, Ausländer/innen konnten etwa schneller in ein Konzentrationslager eingewiesen werden. Mit zunehmendem Arbeitskräftemangel verschlechterte sich die Lage der ausländischen Arbeitskräfte: besondere Erlasse (für Polen im März 1940, für „Ostarbeiter“ im Februar 1942) manifestierten eine Sonderstellung dieser Arbeiter/innen, die vor allem in eingeschränkter Bewegungsfreiheit, etwa dem Verbot der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder „genereller Urlaubssperre“[1], und einer Kennzeichnungspflicht auf der Kleidung bestanden; außerdem wurde die polizeiliche Zuständigkeit für ‚Fremdarbeiter/innen‘ der Gestapo übertragen. Verträge wurden fortan unbefristet geschlossen.
Bis 1942 hatten Arbeiter/innen, besonders aus verbündeten Ländern, die Möglichkeit, sich privat eine Unterkunft zu besorgen. Die Übrigen wurden in Barackenlagern oder Turnhallen untergebracht. Ab Mitte 1942 führten der rapide Anstieg an ausländischen Arbeiter/innen und die zunehmenden Luftangriffe auf deutsche Städte zu Wohnraummangel. Die vermehrt nach Deutschland kommenden „Ostarbeiter“ und „Ostarbeiterinnen“ und ausländische Arbeiter/innen, deren Unterkünfte ausgebombten Deutschen zur Verfügung gestellt wurden, wurden in Lagern untergebracht. Die Behandlung der ausländischen Arbeitskräfte wurde zunehmend der NS-Rassenideologie entsprechend gestaltet. Die Verpflegungssätze für „Ostarbeiter“ und „Ostarbeiterinnen“, Juden und Jüdinnen, Sinti und Sintizze, Roma und Romňija enthielten etwa bei oftmals schwererer Arbeit deutlich geringere Wochenrationen an Fleisch, Brot und Fett als deutsche oder andere Arbeiter/innen. Im Oktober 1942 führte die I.G. Farben als eine der ersten Firmen in ihren Betrieben die „Leistungsernährung“ für ‚Ostarbeiter/innen‘ ein: Wer mehr leistete, konnte Zulagen an Lebensmitteln erhalten, die allerdings denen, die weniger leisteten, entzogen wurden. Erst zwei Jahre später, 1944, wurde diese Methode für Italienische Militärinternierte, sowjetische Kriegsgefangene und ‚Ostarbeiter/innen‘ als behördlich verordnetes Druckmittel eingeführt. In den letzten Kriegsmonaten wurden die Lebensmittelrationen für alle Arbeiter/innen mehrmals gesenkt. Die Unterbringung folgte derselben rassistischen ‚Logik‘: Sowjetischen Kriegsgefangenen wurde beispielsweise nur halb soviel Platz zugesprochen wie anderen Kriegsgefangenen.
Die medizinische Versorgung der ausländischen Arbeiter/innen war generell schlecht. Im Prinzip galt eine Anweisung, nach der Ausländer/innen – mit Ausnahme von polnischen Arbeiter/innen und ‚Ostarbeiter/innen‘ – medizinisch gleich behandelt werden sollten wie Deutsche. Dauerte die Genesung aber länger als drei Wochen, lehnten die Krankenkassen die Behandlung in vielen Fällen ab. Anfang Juli 1944 entschied der „Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz“, Fritz Sauckel, dauerhaft arbeitsunfähige Zwangsarbeiter/innen in Heil- und Pflegestätten einzuweisen, wo sie ermordet wurden.
Jeder freundschaftliche Kontakt zwischen Zwangsarbeiter/innen und „Ariern“ war unter Strafe gestellt, was durch die Bereitschaft vieler Deutscher zur Denunziation verschärft wurde. Frauen unterlagen oftmals einer doppelten Diskriminierung rassistischer und sexueller Art.
Die Bezahlung der ausländischen Arbeiter/innen hing neben der verrichteten Arbeit auch von der Herkunft ab. Die Höhe der Entlohnung sank von den Deutschen über Westarbeiter/innen, Ukrainer/innen, Polinnen und Polen bis zu den ‚Ostarbeiter/innen‘, westlichen Kriegsgefangenen und sowjetischen Kriegsgefangenen immer weiter ab. Für die Arbeit in einer Ruhrzeche bekam ein Deutscher 1944 beispielsweise 8,72 RM pro Tag, ein sowjetischer Kriegsgefangener nur 0,40 RM.
Viele ausländische Arbeiter/innen versuchten, den schlechten Bedingungen zu entfliehen. Ab Herbst 1943 wurden jeden Monat etwa 45.000 Fluchtfälle von ausländischen Arbeiter/innen gezählt, und auch unter den Kriegsgefangenen stieg die Zahl der Flüchtigen stetig an. Trotz der schwierigen Bedingungen – Unterernährung, feindliche Umgebung und große Entfernung nach Hause – gelang es etwa der Hälfte der Flüchtigen, zu entkommen.
Eine traurige Sonderposition unter den Zwangsarbeiter/innen nahmen die Häftlinge von Konzentrationslagern ein. Viele von ihnen lebten nicht nur in ständiger Angst um Leib und Leben, es fehlte auch an der grundlegendsten Versorgung: sie mussten ohne jegliche sanitäre Einrichtung und richtige Schlafgelegenheit auskommen, von der Kleidung zum Wechseln über Bettzeug bis zur Seife fehlte ihnen alles. Daneben wurden sie in der Regel zu den schwersten Arbeiten herangezogen. KZ-Häftlinge, die in Werkshallen arbeiteten, hatten meistens etwas bessere Bedingungen zu erwarten, als diejenigen in den KZ-Baukommandos: sie wurden in ihre Tätigkeiten eingelernt und waren schon deshalb von größerem ‚Wert‘. In einigen Fällen wurde diese Tatsache auch von Unternehmern, wie Oskar Schindler oder Berthold Beitz, als lebenssicherndes Argument für ‚ihre‘ Häftlinge eingesetzt. Diese konnten sich ihres Überlebens dennoch nicht sicher sein: In vielen Konzentrationslagern brachen Krankheiten und Seuchen aus, in den Vernichtungslagern wurden Kranke und Schwache in großer Zahl ermordet.
(BG)