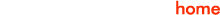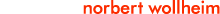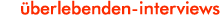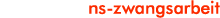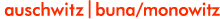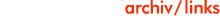NS-Zwangsarbeit: Geschichte, gesetzliche Rahmenbedingungen und Strukturen
1927 wurde in der Weimarer Republik die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung gegründet. Mit verschiedenen Maßnahmen versuchte die Behörde, Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken: Bereits 1932 wurde beispielsweise der sogenannte „Freiwillige Arbeitsdienst“ eingeführt und dem Chef der Reichsanstalt, Dr. Friedrich Syrup, unterstellt. Bis Ende Oktober 1932 wurden im „Freiwilligen Arbeitsdienst“ 254.000 Einsatzwillige beschäftigt.
Daneben existierten Formen erzwungener Kontraktarbeit („Pflichtarbeit“, „Arbeitsdienst“, „Landhilfe“, „Dienstverpflichtung“), die keine freie Wahl des Berufs oder der Arbeitsstelle ermöglichten und ebenfalls durch die Arbeitsämter verwaltet wurden. Die solchermaßen geschaffenen Strukturen und Maßnahmen wurden ab 1933 von der NS-Regierung genutzt: mit dem ‚Arbeitsbuchgesetz‘ (1935) wurden nicht nur Arbeitssuchende, sondern alle Arbeitnehmer systematisch karteimäßig erfasst, und ab März mussten sich alle Schulabgänger „zur Erfassung und Berufslenkung“[1] bei der Berufsberatung melden. Die Reichsanstalt wurde schrittweise ihrer Unabhängigkeit beraubt und schließlich 1939 vollständig ins Reichsarbeitsministerium eingegliedert. Als „Arbeitseinsatzbehörde“ steuerte sie fortan die „Vermittlung der Arbeitskräfte nach dem Bedarf der Wirtschaft, insbesondere der Rüstungsindustrie“[2].
Die rassistische NS-Politik hatte bis 1936 dazu geführt, dass ausländische Saisonarbeiter/innen wegblieben und unter den ‚arischen‘ Deutschen Vollbeschäftigung realisiert werden konnte. Das führte allerdings insbesondere in der Landwirtschaft zu akutem Arbeitskräftemangel. Erste Ansätze, diesen zu beheben, bezogen sich darauf, die Frauenarbeit wieder einzuführen. Dies widersprach allerdings dem Frauenbild in der NS-Ideologie und wurde noch 1942 von Hitler vehement abgelehnt. Erst 1943, nach der Niederlage von Stalingrad, wurden 17- bis 45-jährige deutsche Frauen dienstverpflichtet.
Jüdische Deutsche und ausländische Arbeitskräfte betrachtete die Reichsanstalt spätestens ab 1938 als Arbeitskräftepotential: Nachdem im Jahr 1938 deutsche Männer verstärkt eingezogen wurden, eröffnete der „Anschluss“ Österreichs und de s Sudetenlandes die Möglichkeit, Fachkräfte besonders für die deutsche Landwirtschaft aus diesen Gebieten anzuwerben bzw. „dienstzuverpflichten“.
Ab Anfang des Jahres 1940 mussten die Bezirke und Städte der besetzen Gebiete ein Pflichtkontingent an Arbeitskräften zur Verfügung stellen. Wurde dieses nicht erfüllt, griffen die Besatzungsbehörden bei der Anwerbung zu Tricks, falschen Versprechungen und Gewalt. Die propagierte ‚Freiwilligkeit‘ bei der Meldung zur Arbeit muss daher in vielen Fällen relativiert werden.
Die rassistische Kategorisierung der Bevölkerung, zusammen mit den forcierten Kriegsvorbereitungen des NS-Staates, schuf die Voraussetzungen für die Verordnung des „Geschlossenen Arbeitseinsatzes“ deutscher Juden im Jahr 1938, der die erste durchgreifende Zwangsmaßnahme zur organisierten Ausnutzung jüdischer Arbeitskraft war. Ein Jahr später, mit Kriegsbeginn im September 1939, wurde die „Kriegswirtschaftsordnung“ erlassen, mit der auch deutschen Arbeitskräften die Freizügigkeit eingeschränkt und eine Dienstpflicht auferlegt wurde. Daneben existierten ab 1939 sogenannte Arbeitserziehungslager unter Aufsicht der Gestapo als Zwangsmaßnahme für Arbeiter/innen, die sich der Arbeitspflicht entzogen oder sich den Vorschriften anderweitig widersetzten.
Während für jüdische Arbeitskräfte im Oktober 1941 das „Beschäftigungsverhältnis eigener Art“ geschaffen wurde, mit dem diese außerhalb der üblichen arbeits-, arbeitsschutz- und sozialrechtlichen Gesetzesnormen gestellt wurden, wurden zunehmend auch ausländische Arbeitskräfte zwangsweise zur Arbeit herangezogen, wobei in Art und Schwere der Arbeit wiederum nach der durch die NS-Ideologie definierten Stellung der jeweiligen „Rassen“ unterschieden wurde. Die Einordnung in eine dieser Gruppen bestimmte die Arbeitsbedingungen, Lebensmittelrationen und Lohnzahlungen. Die Löhne der Ostarbeiter/innen, der Polen und Polinnen, der Balten und Baltinnen, der Juden und Jüdinnen, Sinti und Sintizze, Roma und Romňija waren deutlich geringer als die Löhne anderer Ausländer/innen oder der Deutschen. Zudem mussten Polen und Polinnen, Ostarbeiter/innen sowie Juden und Jüdinnen eine „Sozialausgleichsabgabe“ zahlen, wodurch ihr Nettolohn weiter reduziert wurde. Polnische Arbeiter/innen und Ostarbeiter/innen erhielten seit 1940 auch keinen individuellen Arbeitsvertrag mehr. Sie mussten ein Arbeitsbuch führen und waren so noch leichter zu kontrollieren und zu diskriminieren. Anfang 1942 wurden auch Ostarbeiter/innen unter das „Beschäftigungsverhältnis eigener Art“ gefasst. Polnische Arbeiter/innen und Ostarbeiter/innen unterlagen zudem den Vorschriften, die sich aus den „Polenerlassen“ (ab 8. März 1940) und „Ostarbeitererlassen“ (ab 20. Februar 1942) ergaben. Deutlichster Ausdruck dieser Regelungen waren die Vorschriften zur Kennzeichnungspflicht: Polnische Arbeiter/innen hatten ein violettes „P“ auf gelbem Grund, Ostarbeiter/innen ein weißes „OST“ auf blauem Grund an der Kleidung zu tragen. Frauen unterlagen zusätzlichen Repressalien, mussten etwa ihre Kinder in Gewahrsam geben oder wurden im Falle einer Schwangerschaft zur Abtreibung gezwungen.
Ab Oktober 1942 konnte gegen alle ausländischen Arbeiter/innen, die nicht aus einem verbündeten oder neutralen Land stammten, eine „Dienstverpflichtung“ ausgesprochen werden. Diese verbot es ihnen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, wodurch viele, die ursprünglich freiwillig nach Deutschland gekommen waren, zu Zwangsarbeiter/innen wurden. Die Arbeitsschutzbestimmungen wurden in vielen Fällen außer Kraft gesetzt. Kurze Einarbeitungszeiten, fehlende Schutzkleidung und lange Arbeitszeiten ließen die Unfallgefahr steigen. 1944 ließ der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, Fritz Sauckel, die wöchentliche Regelarbeitszeit für Männer auf 60 und für Frauen und Jugendliche auf 56 Stunden erhöhen.
Gesetze wurden regelmäßig der jeweiligen Situation angepasst („Sonderrechtsprinzip“), um die ‚kriegswichtige‘ Produktion und damit das Fortführen des Krieges zu gewährleisten. So wurde etwa am 15. April 1943 ein Merkblatt veröffentlicht, das ost- und westeuropäische Arbeiter/innen gleichsetzen sollte, um gegen den gemeinsamen Feind Bolschewismus vorzugehen. Eingesetzt wurden die Zwangsarbeiter/innen überwiegend in der Landwirtschaft und in der Industrie. Sie waren, je nach Einsatzort, in Privathaushalten, Barackenlagern oder, im Falle vor allem jüdischer Zwangsarbeiter/innen, in Konzentrationslagern untergebracht. In den letzten Kriegsmonaten wurden sie vermehrt für Reparatur- und Befestigungsarbeiten herangezogen.
Die unmenschlichste Form der Zwangsarbeit mussten Menschen erleben, die in ein Konzentrationslager deportiert wurden. KZ-Häftlinge, zumeist jüdische Häftlinge, die innerhalb der nationalsozialistischen Rassenideologie auf der untersten Stufe standen, waren jeglicher Rechte beraubt und dem Terror der SS schutzlos ausgesetzt. In vielen Fällen wurden die Häftlinge von der SS gegen eine geringe Gebühr an Firmen ‚verliehen‘. Hier mussten sie – meist unter furchtbaren Bedingungen – Schwerstarbeit leisten. Von etwa 1,65 Millionen Menschen, die zwischen 1933 und 1945 zur Zwangsarbeit in ein KZ deportiert wurden, wurden nur etwa 100.000 wieder regulär entlassen, es überlebten höchstens 475.000.
Diejenigen, die die letzten Kriegsmonate, oft ohne jegliche Lebensmittelversorgung, und die zahlreichen Massenhinrichtungen gegen Kriegsende überlebten, wurden zu Displaced Persons(DPs). Diese Personen befanden sich außerhalb ihrer Heimatländer und wurden in diesen oftmals der Kollaboration mit den Deutschen beschuldigt. Daher hatten viele wenig Interesse, dorthin zurückzukehren. Besonders in der UdSSR wurden viele Rückkehrer/innen mit Zuchthaus und erneuter Zwangsarbeit bestraft. In den folgenden Jahrzehnten gab es zahlreiche juristische Auseinandersetzungen um Entschädigungszahlungen zwischen ehemaligen Zwangsarbeiter/innen und Betrieben, die von ihrer Arbeitskraft profitiert hatten.
(BG/SP)